|
|
DIE ZEIT Nr. 27, 30.06.2005 ZEITLÄUFTE, S. 88 |
|
Eine deutsche Hölle |
|
Im Juli 1905 erheben sich die Völker Ost-Afrikas gegen die wilhelminische Kolonialherrschaft zwei Jahre später ist der Maji-Maji-Aufstand in Blut ertränkt |
 |
|
von Bartholomäus Grill |
|
Hochverehrte Herrschaften, treten Sie ein in unseren kleinen Kolonialpark! Hier, auf diesen prächtigen Terrakotta-Reliefs, sehen Sie Askari maschieren, schwarze Soldaten, die dem weißen Herrn und Offizier treu ergeben sind. Und das Denkmal dort drüben, die Stele mit dem Reichsadler, ehrt unsere tapfere Schutztruppe in Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika. Heia Safari! Meine Damen und Herren, erleben Sie die Zeiten, als Deutschland noch zukunftsfähig und gesinnungsfest die Welt zivilisierte und vor der Globalisierung nicht verzagte! |
 |
 |
 |
|
Lehrreich hätte er werden sollen, der Tansania-Park neben der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne in Hamburg-Jenfeld, benannt nach dem preußischen Erzkolonialkrieger und späteren Kapp-Putschisten Paul von Lettow-Vorbeck. Ein bisschen exotisch wollte man den Park gestalten, aber auch ein bisschen politisch korrekt. Die Initiatoren vom Kulturkreis Jenfeld e.V. hatten nämlich geplant, den Tansania-Pavillon, der auf der Expo 2000 in Hannover zu bewundern war, zwischen den großdeutschen Denkmälern aufzustellen, die einst die Kaserne zierten, und somit ein "Zeichen der Völkerverständigung" zwischen Deutschland und Tansania (ehemals Deutsch-Ostafrika) zu setzen. Bei aller Verständigung aber muss auch umgekehrt mal die Frage erlaubt sein, nicht wahr, was aus den armen Menschen dort unten geworden wäre ohne die Straßen und Missionsschulen und Hospitäler, die von den deutschen Kolonialherren gestiftet wurden. Es war doch eine Art Entwicklungshilfe, schon damals. Außerdem haben es die Afrikaner "unter deutscher Herrschaft besser gehabt als unter den Engländern". Da ist sich jedenfalls Horst Junk, der Vorsitzende des Kulturkreises, ganz sicher. |
 |
 |
 |
|
Aber ausgerechnet diese Afrikaner machen bei den schönen Plänen seines Vereins nicht mit. Frederick Sumaye, der Premierminister von Tansania, blieb unentschuldigt der Einweihungsfeier im September 2003 fern, und wann der Expo-Pavillon aufgestellt wird, weiß der Himmel. Offenbar sieht man in Tansanias Hauptstadt Daressalam die Kolonialgeschichte doch etwas anders als in Hamburg. |
 |
 |
 |
|
Vor allem in diesem Jahr gehen die historischen Ansichten weit auseinander, denn im Juli ist es genau hundert Jahre her, dass sich der Süden der Kolonie Deutsch-Ostafrika gegen die weiße Fremdherrschaft erhoben hat. In Tansania sprechen die Historiker zum Beispiel nicht von einem Aufstand wie hierzulande, sondern von einem vita vya ukombozi, einem Befreiungskrieg. |
|
Der Gott des Wassers ruft zur Freiheit |
|
Im Sommer 1905 hatte er begonnen, am 20. Juli. Auf einer Baumwollplantage nahe dem Dorf Nandete reißen die Arbeiter die Stauden aus der Erde. Was zunächst aussieht wie eine ganz gewöhnliche Arbeitsverweigerung, ist tatsächlich eine Kriegserklärung. Die ertragreichen Baumwollpflanzen werden vom Volk gehasst, sie sind Symbole der Zwangsarbeit und Ausbeutung. Der Akide von Kibata er ist der von den Deutschen installierte Statthalter entsendet eine Hand voll Männer, um die Ruhe wieder herzustellen. Doch sie werden davongejagt, und kurz darauf muss der Akide selbst fliehen, denn die Aufständischen überrennen seinen Amtssitz. |
 |
 |
 |
|
Rasend wie ein Buschfeuer greift die Rebellion von Nandete auf das Land der Matumbi am Rufiji und auf den ganzen Süden der Kolonie über; die furchtbarsten Albträume der europäischen Siedler werden wahr. Aus den Gesindehütten wehen nächtens unheimliche Gesänge in ihre Häuser, sie hören Kriegstrommeln dröhnen und sehen Schatten huschen. Als die erste Plantage in Flammen aufgeht und der erste Pflanzer, ein Mann namens Hopfer, totgeschlagen wird, ist der Krieg nicht mehr aufzuhalten. Elf Tage nach dem Zwischenfall von Nandete erobern und plündern tausend entfesselte Kämpfer den Küstenort Samanga. |
 |
 |
 |
|
Während die Kolonialpresse immer noch von 'Überfällen', 'ungünstigen Vorgängen' und 'Unruhen' schreibt und 'afrikanische Zauberer' dafür verantwortlich macht, ist der erste antikoloniale Befreiungskampf in der Geschichte Afrikas längst in vollem Gange. Die Ngoni, die Pogoro, die Mbunga, die Bena, immer mehr Völker schließen sich ihm an, am Ende sind es ihrer zwanzig. Von der Küste des Indischen Ozeans im Osten bis zum Nyasa-See im Westen, von den Ufern des Rufijis bis zum Rio Ruvuma, überall ist ihr Schlachtruf zu hören: 'Maji-Maji!' |
 |
 |
 |
|
Die Kolonialisten vernehmen ihn zunächst ratlos. Sie wissen zwar, dass maji in der Verkehrssprache Kisuaheli 'Wasser' bedeutet. Aber von Bokero haben sie noch nie gehört. Bokero ist ein Kimulungu, einer jener Geister und Gottheiten, denen die Menschen folgen, trotz heftigster Versuche der deutschen Missionare, ihnen den animistischen Glauben auszutreiben. Bokero wohnt in den Stromschnellen des Rufijis, ein Gott des Wassers, ein Gott des Lebens. Er sendet Regen, tränkt die Erde, das Vieh, gibt den Menschen Kraft, schenkt Fruchtbarkeit und Reichtum. Er ist mächtiger als der Christengott. |
 |
 |
 |
|
Aber jedes höhere Wesen braucht eine Stimme, ein Medium, durch das es den Sterblichen seine Botschaft verkündet. Für Bokero spricht Kinjikitile, ein traditioneller Heiler, eine hoch gewachsene Gestalt aus dem Dorf Ngarambe, der magische Kräfte besitzt und stets im lilienweißen Kanzu, einem beinlangen Gewand, auftritt. Aus dem Munde dieses Propheten ruft Bokero zum Widerstand gegen die Deutschen auf; zugleich verheißt er den geschundenen Menschen Freiheit, Selbstachtung und Wohlstand. |
 |
 |
 |
|
Die Heilslehre verbreitet sich in Windeseile. Die hongo genannten Sendboten des Maji-Kultes tragen sie auf den präkolonialen Sklaven- und Handelsrouten ins Landesinnere, bis in das verborgenste Dorf. Die Botschafter preisen auch die Allmacht des maji, des magischen Wassers, das, mit Hirse verkocht, als Kriegsmedizin eingenommen wird. Man ist felsenfest davon überzeugt, dass es die Kugeln des Feindes abperlen lässt wie Regentropfen und jeden Kämpfer unverwundbar macht ein fataler Irrglauben, wie sich rasch herausstellt. |
 |
 |
 |
|
Verwandte Kulte gibt es übrigens bis heute in Afrika. Dem Chronisten sind sie in Sierra Leone in Gestalt der Kamajor-Jäger begegnet und in den Urwäldern des Ostkongo, wo sie sich Maï-Maï nennen. Sie verkörpern in den kriegsgeplagten Staaten mit ihren zerrütteten Gemeinwesen und schwer traumatisierten Menschen die letzten Abwehrkräfte gegen zerstörerische Außenmächte. Ihre Mission wird häufig von chiliastischen Erneuerungs- und Erlösungsideen getragen. Genau das wollten auch die Völker in Deutsch-Ostafrika: erlöst werden vom Joch des Kolonialismus. |
 |
 |
 |
|
Ihr Leben war immer unerträglicher geworden, und das hing mit der verschärften Ausbeutung der Kolonien seit Beginn des 20.Jahrhunderts zusammen. Nach der Berliner Konferenz von 1884/85 hatten die Imperialmächte Afrika unter sich aufgeteilt und die neuen Territorien endgültig unterworfen. Sodann begannen die Eroberer, die fruchtbaren Regionen des Kontinents mit Pflanzungen zu überziehen. Sisal, Kautschuk, Zucker, Bananen, Erdnüsse, Kakao, Tee, Kaffee, Tabak, Kopra, Baumwolle der Anbau dieser cash crops für die Märkte der 'Mutterländer' schuf nicht nur jene Monokulturen, von denen viele Staaten Afrikas nach wie vor abhängig sind, sondern auch ein strukturelles Nahrungsmitteldefizit, das in Dürrezeiten regelmäßig zu Hungersnöten führte und immer noch führt. Denn die kleinen Subsistenzbauern wurden ihres Landes beraubt und auf unfruchtbare Flächen abgedrängt; sie waren nicht mehr in der Lage, ihre Großfamilien zu ernähren, und daher gezwungen, ihre Arbeitskraft auf den Plantagen zu verkaufen. Die Menschen, gerade erst dem arabisch-islamischen Sklavenhandel entkommen, wurden so zu Lohnsklaven der europäisch-christlichen Ökonomie. |
 |
 |
 |
|
Daheim im Deutschen Reich indes wuchs die Kritik am teuren Kolonialabenteuer, denn bis zur Jahrhundertwende brachte das ferne Neuland dem Staat selbst nur Verluste. Während einzelne Unternehmen längst üppige Profite einfuhren, blieb der Kolonialapparat auf Zuschüsse angewiesen, um die Verwaltung, das Militär und den Aufbau der Infrastruktur zu finanzieren. Nun sollten diese Investitionen endlich Gewinn abwerfen. |
 |
 |
 |
|
Seit 1898 wurde den 'Eingeborenen' eine so genannte Hüttensteuer abgepresst. Das Steuerwesen war das Kernstück der zivilisatorischen Mission, den 'faulen Neger' zum fleißigen Untertan zu erziehen. Die Afrikaner waren fortan genötigt, in die Knechtsdienste der weißen Herren zu treten, ihre Waren zu kaufen, ihre Herrschaft zu finanzieren. Die Subsistenzgemeinschaft wurde in eine Arbeitsgesellschaft verwandelt, die moderne Geldwirtschaft verdrängte den herkömmlichen Tauschhandel. |
 |
 |
 |
|
Am 22. März 1905 wurden die Steuern weiter verschärft. Gouverneur Gustav Adolf Graf von Götzen ließ verfügen, dass sie nicht mehr pro Hütte, sondern pro Kopf zu erheben seien, was ungefähr auf eine Vervierfachung der Steuersumme hinauslief. Zudem durften sie fortan nicht mehr in Naturalien gezahlt werden. |
 |
 |
 |
|
Die Arbeit auf den Baumwollfeldern war hart, "voller Leiden, aber der Lohn war die Peitsche", klagt Ndundule Manganya, eines der wenigen Opfer, deren Zeugnis überliefert ist. "Und dann sollten wir den Deutschen noch Steuern zahlen. Waren wir denn keine Menschen?" Besonders gefürchtet war die Kiboko, die Nilpferdpeitsche. Die in Ketten gehaltenen Arbeiter, Frauen wie Männer, mussten bei erbärmlicher Kost sieben Tage die Woche schuften, viele wurde totgeprügelt, viele starben an Entkräftung. |
 |
 |
 |
|
Vier Monate nach dem Steuererlass erhoben sich die 'Eingeborenen'. Der Landraub, die durch das Steuerdiktat erpresste Zwangsarbeit, die grausamen Misshandlungen es war zu viel geworden. Graf von Götzen, ganz Vertreter der Elite seines Standes, seines Reiches, seiner Rasse, erkannte allerdings keinerlei Zusammenhang. Er vermutete die Ursache des Aufbegehrens allein in der "unvermeidbaren Unzufriedenheit des Naturmenschen mit der vordringenden Zivilisation und ihrer Forderung zur Arbeit". Mit anderen Worten: Der Bantu begehrte auf, weil er seine ihm angeborene Faulheit verteidigte. |
 |
 |
 |
|
Nach anfänglichen Erfolgen der Maji-Maji-Kämpfer schlagen die im Oktober 1905 verstärkten 'Schutztruppen' mit aller Macht zurück. Ihre 'Strafexpeditionen' enden häufig in blanken Massakern, denn die Aufständischen sind zwar zahlreich, aber mit ihren Speeren, Keulen, Pfeilen und antiquierten Schießgeräten hoffnungslos unterlegen. Wie überall in Afrika setzen die Europäer eine vernichtende Waffe ein, das moderne Maxim-Maschinengewehr. "Whatever happens, we have got / the Maxim Gun, and they have not", zynelt der erzkatholische Schriftsteller Hilaire Belloc: "Was immer auch geschieht, wir haben das Maxim-MG, und sie haben’s nicht." |
 |
 |
 |
|
Schon bald meiden die Maji-Maji-Kämpfer offene Feldschlachten und verlegen sich auf eine Guerillataktik. Die Deutschen antworten mit 'verbrannter Erde'. Sie schneiden Versorgungswege ab, vergiften Brunnen, vernichten Felder und Vorratsspeicher, machen Dörfer dem Erdboden gleich, knüpfen Gefangene am nächsten Baum auf. 'Befriedung' nennt man das. Einer der ersten Gehenkten ist übrigens der Prophet Kinjikitile. |
 |
 |
 |
|
Der Krieg dauert zwei Jahre, dann kommt njaa, der große Hunger, und mit ihm kommen die Seuchen. "Kein frohes Leben ist zu beobachten", stellt das katholische Missionsblatt anno 1907 fest. Die Mitteilungen der Seelenfischer geben eine Vorahnung vom Massenelend, das Afrika im 20. Jahrhundert heimsuchen wird, sie lesen sich wie Depeschen über die Katastrophen unserer Tage. Von zu Skeletten abgemagerten Kindern berichten die Missionare, von aufgequollenen Bäuchen, von der roten Ruhr, vom Leichengestank. Abertausende sterben an Hunger und Krankheiten, am Ende sind ganze Landstriche entvölkert. Das Kolonialregime beziffert die Zahl der Toten auf 75.000, der tansanische Historiker Gilbert Gwassa glaubt, dass es bis zu 300.000 sind. Von "mehr als 100.000 Menschen", die umkamen, sprechen Felicitas Becker und Jigal Beez, die Herausgeber eines exzellenten Buches zum Thema, das gerade im Ch. Links Verlag Berlin erschienen ist (Der Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika 19051907; 240 S., Abb., 22,90 €). Wohl eine realistische Schätzung. |
 |
|
Zigaretten und Sauerkraut für die Askari |
|
Aufseiten der 'Schutztruppe' waren 15 Weiße und 389 Afrikaner gefallen. Die viel gerühmten Askari, die schwarzen Landser, gehörten neben den verrohten deutschen Soldaten zu den berüchtigsten Menschenschindern. Sie kamen aus Nubien, dem heutigen Sudan, oder aus anderen Regionen der Kolonie und hatten keinerlei Beziehung zu den aufständischen Völkern. |
 |
 |
 |
|
Später schwärmten die Askari von ihrer 'Kampfzeit', als wär’s ein Pfadfindermanöver gewesen. Das passt bis heute perfekt in die Geschichtsfantasien des Traditionsverbandes der ehemaligen Schutz- und Überseetruppen. Der Engländer war brutal, nicht wahr? Und der Portugiese erst! Vom Belgier gar nicht zu reden. 'Unsere Neger' aber mochten uns. So reimt sich der Kolonialterror zum zünftigen Heia Safari. |
 |
 |
 |
|
Malonde Maseru hat das stets gerne bestätigt; er war ein tansanischer Veteran voll deutscher Heldensagen. Wir besuchten den steinalten Mann vor zehn Jahren in seinem Dorf Mapotjomi. Stramm wie ein junger Infanterist schritt er in seinen Sandalen aus Reifengummi auf uns zu. "Die Deutschen haben uns immer gut behandelt", erzählte er. Es habe immer genug ugali (Maisbrei), Sauerkraut und Zigaretten gegeben. Jedes Mal, wenn Maseru den Namen Kaiser Wilhelm aussprach, salutierte er. Unvergesslich zu Beginn des Ersten Weltkriegs die Schlacht bei Tanga, am 4. und 5. November 1914, als "wir die Engländer zurückgeschlagen haben". Seinerzeit fielen "48 brave Askari", an die heute noch das Kriegerdenkmal an der Eckernforde Avenue in Tanga erinnert. "Eine schöne Zeit war das." Malonde Maseru, der fröhliche Zeuge einer dunklen Epoche. Das jährliche Treuegeld, das er bis zu seinem Tode von der Bundesrepublik Deutschland erhielt, versilberte seine Vergangenheit. |
 |
 |
 |
|
Von der Eckernforde Avenue zurück in die Wilsonstraße 1 in Hamburg-Jenfeld, zum Askari-Denkmal des Bildhauers (und Kolonialoffiziers) Walter von Ruckteschell. Wohin mit dem Nazi-Kitsch? Was wird aus dem Tansania-Park? Soll er zum Gedenken an unsere glorreiche Kolonialzeit doch noch vollendet werden? Die Hamburger Obrigkeit ist irgendwie dafür, denn schließlich ist auch die tansanische Regierung irgendwie nicht dagegen, wie eine Besuchsdelegation des Senats im Januar herausgefunden haben will. Afrikanisten wie Ludwig Gerhardt kritisieren den "geschichtsverfälschenden Eindruck" der Monumente und warnen davor, dass der Park zu einer "Pilgerstätte der Ewiggestrigen" werden könnte. Dafür wurde er in einem anonymen Brief bereits als "antideutsche Drecksau" entlarvt. |
 |
 |
 |
|
Ein paar Bürger erzürnen sich über das Projekt, aber die Mehrheit nimmt es ebenso wenig wahr wie die vielen Denkmäler, Straßennamen, Speicher oder Kontorhäuser, die vom Geist des wilhelminischen Imperialismus künden und von den Profiten, die Hamburg einst aus der kolonialen Raubwirtschaft gezogen hat. Inzwischen legte die Künstlerin Jokinen, verbunden mit ihrem Internet-Projekt www.afrika-hamburg.de, ein Alternativkonzept für einen Park der Kolonialdenkmäler (Park Postkolonial Anm. d. V.) vor. Sie will ihn nach dem Modell des Budapester Szoborparks für Statuen des Stalinismus und Staatskommunismus gestalten. Eine treffliche Idee. Denn so wären auch die wilhelminischen Kolonialkriege in Afrika, ob in Deutsch-Südwest oder Deutsch-Ost, endlich als das erkannt und benannt, was sie sind: Menschheitsverbrechen. |
|
|
|
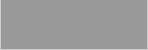
![]()